Deutschland. Gleich hinter dem offen stehenden Eingangstor zum Gelände der Glashütte Haidemühl reihen sich zehn feuerverzinkte Stahlcontainer auf. Einige davon sind offen. Anfassen, um sie zu schließen, will wohl keiner mehr. Sie sind randvoll mit schwarzer Schmiere. Ich kann einzelne Behälter erkennen, die von dicker schwarzer Kruste an der Oberfläche gehalten werden. Es sind Plastikflaschen und Alukanister. Auf einem erkenne ich etwas Schrift auf einem vergilbten Etikett. “Entzündlich” steht drauf. Auf dem Kanister liegt ein kleines gelbes Blatt von einer Birke. Daneben kleben einige Birkensamen im schwarzen Schleim.

Unbeauftragte, unbezahlte Werbung. Der Artikel enthält Affiliate-Links.
Disclaimer: Das Betreten von Lost Places kann gefährlich sein. Dieser Artikel stellt keine Handlungsempfehlung dar, sondern hat rein informativen Charakter. Es wird keine Haftung übernommen.


Es war einmal… Glanz und Glorie in der Glashütte Haidemühl
Die erste Glashütte in Haidemühl wurde im Jahr 1835 vom Glasfabrikanten Greiner errichtet. Hier wurden Hohlgläser, Lampenschirme und Parfümgläser hergestellt. Es folgten mehrere Wechsel der Besitzer, Konkurs, Rekonstruktionen, kriegsbedingte Betriebseinstellungen und schließlich Modernisierungen in den 60er Jahren. Damals galt die Glashütte Haidemühl als eines der modernsten Werke der DDR. Rund 1280 Menschen hatten hier ihre Arbeit. Nur hier wurden ab 1971 die 0,5 Liter Milchflaschen hergestellt, die damals auf fast jedem Frühstückstische standen. Sie wurden sogar in den Westen exportiert. Rund 345.000 Flaschen sollen hier jeden Tag vom Band gelaufen sein.

Nach der Wiedervereinigung übernahm dann die Treuhand das Werk und verkaufte es an einen Investor aus dem Westen. Investiert wurde hier jedoch nichts mehr. Im Gegenteil: die Maschinen wurden verkauft und kurz darauf, im Jahr 1992, wurde die Produktion eingestellt. Das Schicksal der Glashütte war zu dieser Zeit kein Einzelfall. Vielen Betriebe der früheren DDR erging es ähnlich. Und bei vielen wurde nicht aufgeräumt, Altlasten und Müll blieben an Ort und Stelle. Umweltskandale wurden oft erst viele Jahre später aufgedeckt.



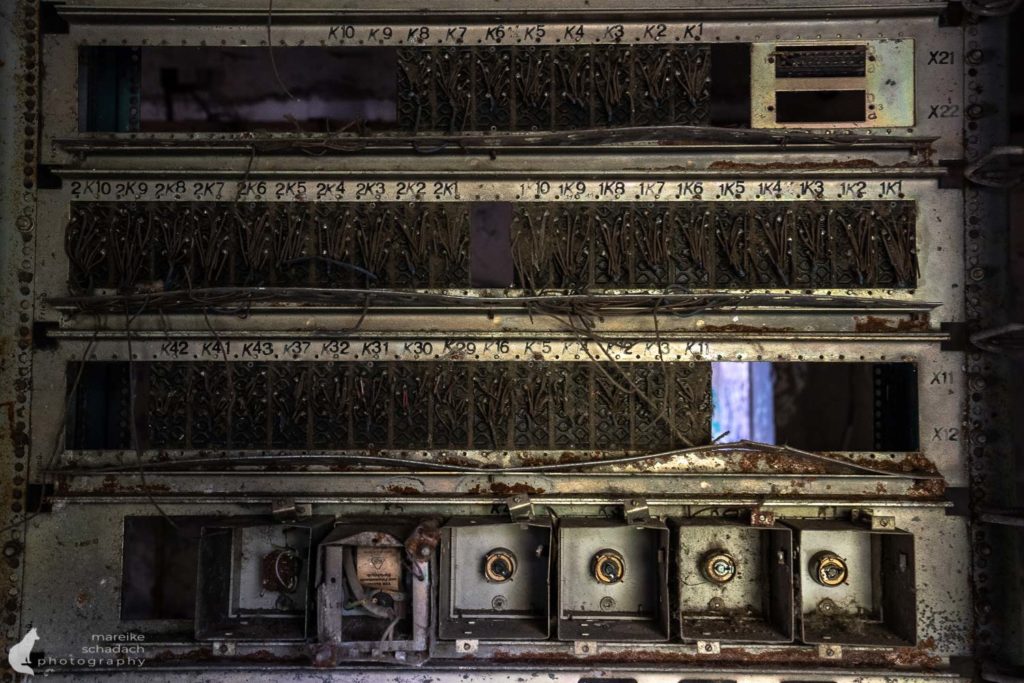
Birken und tonnenweise Kaliumcarbonat
Ich gehe weiter und komme zu einer großen Halle. Hier haben die Birken schon Wurzeln geschlagen. Wählerisch sind diese ja nicht, sie wachsen als Pionierpflanzen fast überall. Unter dem undichten Dach der Halle stapeln sich unzählige Säcke mit Kaliumcarbonat aus Taiwan (Taiwan Pulp & Paper Co.) und Südkorea (Korea Potassium Chemical Co. Ltd.). Jedes Gebinde enthält 1000 Kilogramm. Viele sind im Laufe der Zeit aufgeplatzt und das Pulver verteilt sich über den Boden der Halle. Dort, wo das Hallendach eingestürzt ist, wächst Moos auf dem weißen Pulver. Daneben liegen löchrige Säcke voller Glasscherben. Nein, wählerisch sind die Birken wirklich nicht.

An den Wänden der Lagerhalle bringen ein paar bunte Graffiti Farbe und Frohsinn in die graue Tristesse des Glaswerks. Ich hoffe, die Sprayer haben keinen Pulverstaub eingeatmet. Denn Kaliumcarbonat kann schwere Reizungen der Atemwege hervorrufen. Auch die Augen werden von dem ätzende Staub angegriffen. In den Sicherheitsdatenblättern wird beim Arbeiten mit Kaliumcarbonat das Tragen von Handschuhen und Atemmaske geraten.

Kaliumcarbonat – Verwendung und Wirkung
Kaliumcarbonat ist auch als Pottasche bekannt. Als Backtriebmittel ist es eine traditionelle Zutat insbesondere für Weihnachtsgebäck. Hier in der Glashütte Haidemühl wurde es als Flussmittel bei der Glasproduktion eingesetzt. Mit Hilfe der Flussmittel werden die Schmelztemperaturen von gebranntem Kalk (2500 °C) und Quarzsand (1700 – 2000 °C) auf rund 1450 °C, die normale Betriebstemperatur im Glasofen, gesenkt und somit Energie gespart.
Bei Kontakt mit der Haut kann Kaliumcarbonat ätzend wirken. Sicherheitsdatenblätter warnen vor schweren Haut-, Augen- und Atemwegsreizungen beim Menschen. Gleiches trifft vermutlich auch für die Schleimhäute von Tieren zu, die sich zu nah heranwagen.

Das Pulver soll in dicht verschlossenen Behältern an einem trockenen Ort aufbewahrt werden. Dabei ist das Eindringen in die Kanalisation, in Oberflächen- und Grundwasser sowie in das Erdreich zu verhindern. In Wasser ist Kaliumcarbonat sehr leicht löslich. Die Lösung reagiert durch Bildung von Hydroxidionen alkalisch. Von Kaliumcarbonat selbst sind keine ökotoxikologischen Wirkungen bekannt. Biologische Effekte werden hauptsächlich durch die Erhöhung des pH-Wertes im Gewässer verursacht. Denn der pH-Wert ist ein sehr wichtiger Regulator von chemischen und biologischen Prozessen. Stark saure und alkalische Verhältnisse können auf Organismen toxisch wirken. So kann zum Beispiel ein zu hoher pH-Wert im Wasser vorhandenes Ammonium in für Fische giftiges Ammoniak umwandeln.

Es tut sich nichts
UPDATE, Nov. 2023: Das Gelände ist inzwischen eingezäunt und die Stahlcontainer im Eingangsbereich wurden abtransportiert.
Aber warum gammeln an der Glashütte Haidemühl nach 30 Jahren noch immer die Altlasten vor sich hin?
Ein Jahr nach Einstellung des Betriebes der Glashütte Haidemühl wurde festgelegt, dass der Fabrikstandort und die umliegende Ortschaft dem Braunkohletagebau weichen sollten. Die Einwohner der Siedlung sind schon vor langem umgesiedelt. Die LEAG, die den Braunkohletagebau Welzow-Süd betreibt und auch hier Braunkohle abbauen will, hat den Kauf bisher nicht abschließen können. Grund sind je nach Quelle ungeklärte Eigentumsverhältnisse oder unterschiedliche Vorstellungen zum Kaufpreis.

Für die Gemeinde Welzow ist das Grundstück schon lange ein Greul. Auf meine Anfrage hin versicherte die Bürgermeisterin, dass die Gemeinde “seit Jahren alles unternommen haben, um diese desolaten und nur schwer akzeptierbaren Zustände zu beseitigen. Wir stehen mit allen Beteiligten in einem ständigen Austausch. Das Bergbauunternehmen ringt um eine Lösung, die hoffentlich in den nächsten Jahren zu einer sach- und fachgerechten Entsorgung der Altlasten führen wird.”


Zwischen den Hallen haben die Bäume nach 30 Jahren schon eine stattliche Größe erreicht. Es scheint sie nicht zu stören, dass sich ihre Wurzeln den Weg zwischen Glasscherben suchen müssen. Die Glasflaschen leuchten nach 30 Jahren immer noch, wenn die Sonne auf sie scheint. Die meisten sind grün. Nur ab und zu sehe ich durchsichtige Glasflaschen. In ihrem Innern wächst Moos, das sie langsam aber sicher grün färbt.

Büchertipps für Lost Places und verlassene Orte in Berlin und weltweit
Ihr wollt noch mehr Lost Places entdecken? Dann hab ich hier drei Buchempfehlungen für euch. Die Bücher* könnt ihr mit einem Klick auf die Bilder bei Amazon bestellen. Wenn ihr über einen Affiliate-Link ein Buch oder einen anderen Artikel kauft, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision und ihr helft mir, Fernweh-Motive weiterhin mit interessanten Artikeln zu füllen. Das Produkt wird für euch dadurch nicht teurer.
Habt ihr noch Anmerkungen oder Anregungen zu meinem Artikel? Wenn ja, dann schreibt mir doch einen Kommentar!
Wollt ihr wissen, wenn es neue Artikel auf meinem Blog gibt? Dann folgt mir doch auf Facebook, Pinterest oder Instagram. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinen Artikel mit euren Freunden teilt.
Empfehlungen zum Weiterlesen
Liebt ihr verlassene Orte genauso sehr wie ich? Dann schaut euch mal meine beiden folgenden Artikeln an:












Hallochen,
vorgestern, 24.9.23, war ich in Haidemühl um dort einige Luftaufnahmen zu erstellen.
Mein vorheriger Besuch innerhalb des Geländes war 03-2017.
Mittlerweile ist das Gelände komplett eingezäunt. Beide Seiten der Straße. Die Natur hat sich das Gebiet zurück erobert. Der Tagebau ist nur wenige hindert Meter von dem Gelände entfernt, man sieht es von oben sehr gut.
Gut Licht und immer volle Akkus, Gruß Ingo.
Hallo Ingo, vielen Dank für die Info! Grüße, Mareike
Hallo Mareike,
dem Beitrag von Ingo ist nur wenig zuzufügen; Absperrungen sind vorhnden, aber wo Absperrungen, da auch “Löcher”; zusätzlich dazu sind jetzt vielfach Elektrozäune installiert (und in Bertrieb!), um eine weitere Ausbreitung der Schweinepest durch Wildtiere zu verhindern. Das sollte man auch akzeptieren. Kaliumcarbonat ist mir durchaus bekannt (wurde früher auch in der Analogfotografie als Laborchemikalie mit entsprechenden Hinweisen verwendet) und ich kann die Warnhinweise nur dringend unterstützen, das gilt im Grunde für nahezu jedes Lost Place; 30 Jahre Stillstand, Wandalismus, Altlasten und Natur sorgen durchaus für Gefahren, unberechenbare Untergründe, Decken und Dächer.
Mehr als 5 Jahre zuvor habe ich die Gegend um Welzow “bereist” und war auch in der Glashütte, mein letzter Besuch war nun, mehr unbeabsichtigt, am 1. Oktober 2023, und selbst die vier Stunden in der Glashütte und Siedlung waren zu wenig für eine umfangreiche Dokumentation. Wer sich vielleicht nach solchen Lost Places mehr für das Herstellen von Glas interessiert, dem empfehle ich den Besuch des Museumsortes Glashütte bei Baruth, von der Anlage her mit Wohnumfeld wie Glashütte Haidemühl, nur wesentlich kleiner, aber älter.
In meiner Glassammlung befinden sich auch einige Objekte aus Haidemühl mit dem markanten Firmenlogo, nicht nur Milchflaschen. Das Firmenlogo ist übrigens bei diffusem Licht strassenseitig im Giebelfeld der alten Zugangsgebäude noch zu erkennen.
Alles Gute, herzliche Grüße, Peter
Hallo Peter,
ganz lieben Dank für dein Update zu der Glashütte. Es hat mich damals sehr erstaunt, dass alles so zugänglich war und dass die Chemikalien da noch immer vor sich hinrotten. Jetzt wird anscheinend langsam was getan. Ich werde auf jeden Fall bei Gelegenheit vorbeischauen und die Veränderung verfolgen…und um das Firmenloge zu suchen. Das habe ich beim letzten Mal nicht entdeckt. Danke auch noch für den Tipp mit der Glashütte bei Baruth, die behalte ich auf jeden Fall im Hinterkopf und werde sie besuchen, wenn ich in der Gegend bin.
Alles Gute und liebe Grüße, Mareike
Hallo Mareike,
hier ein gering verspäteter Gruß aus Haidemühl; ich war dort , um noch mal einen Rundgang zu machen (Ergänzungsfotos, Details…). Gravierende Änderungen gabs nicht, lediglich die Bäume haben ihr Laub verloren und geben mehr Sicht auf die Gebäude frei. Doch, es gibt sogar etwas Positives, die Stahlcontainer mit der nichtidentifizierbaren Pampe sind verschwunden, immerhin. Haidemühl war diesmal nur eine Zwischenstation auf dem Weg nach Weisswasser zum dortigen Glasmuseum; ganz nett, informativ und überschaubar.
Liebe Grüße, Peter
Hej Peter,
na, das ist doch schonmal ein Anfang…wer weiß, was da alles für ein Zeug drin war. Vielen Dank für die Info. Mal schaun, wann ich da mal wieder vorbei komme. Aber dann schau ich auf jeden Fall mal, ob es weiter gegangen ist mit dem Aufräumen.
Liebe Grüße
Mareike